Der Lilienfelderhof in alten Urkunden
Gunther Kacerovsky, 2010
Der Lilienfelderhof zu Pfaffstätten
ist nicht nur eines der imposantesten Hauskomplexe in Pfaffstätten, sondern
auch ein eindrucksvolles Beispiel eines ökonomisch relevanten Stiftshofes des Zisterzienserklosters
Lilienfeld, das 1202 gegründet wurde.
Als Errichtungsjahr dieses Hofes
wird seit Jahrhunderten 1216 überliefert. Es ist an der Zeit, dieses Datum
anhand der Dokumentenlage kritisch zu überprüfen.
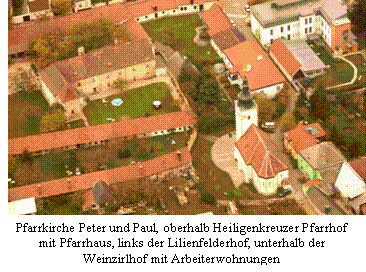
Besitz des Stiftes Lilienfeld in
Pfaffstätten ist aus der Gründungszeit des Stiftes Lilienfeld überliefert: aus
der Stiftungsurkunde Leopold des VI., dem Glorreichen von 1209 erfahren wir, dass die Mönche - es sind Zisterzienser aus
Heiligenkreuz - vom Gelde des Herzogs 2 Weingärten in Pfaffstätten kaufen[1].
In den nun folgenden
Bestätigungsurkunden ist der Besitz Lilienfelds in Pfaffstätten immer mit 2 Weingärten
angegeben:
20.Jänner 1223, Rom Lateran: Papst Honorius III. bestätigt dem Abt und
Konvent von Lilienfeld den päpstlichen Schutz und alle Besitzungen: den
Klosterort mit allen Zugehörungen, bei Phafsteten 2 Weingärten[2].
8. Mai 1230, Rom Lateran: Papst
Gregor IX. bestätigt neuerdings die Stiftung Lilienfelds, 2 Weingärten in Phafstetin[3].
Auch in der Besitzbestätigung 1257 König
Ottokars findet sich keine Spur eines Hofbesitzes in Pfaffstätten, immerhin
sind es nun 8 Weingärten geworden: 9.Mai
1257, Wiener Neustadt – Münchendorf:
König Ottacharus bestätigt Besitz, Rechte und Freiheiten des Klosters Lilienfeld
gemäß den Stiftungen der Herzöge Leopold
und Friedrich, 8 Weingärten in Phafstetin[4]
Dann aber, im Jahre 1261 liest man plötzlich:
Livpoldus de Sachsengange, seine Frau Margareta
und seine Kinder schenken dem Kloster Lilienfeld zu ihrem Seelenheil
Grundstücke beim Lilienhof (domus liliorum). Diese Bauplätze (areas) liegen
beim Tor des Hofes (ante portas ea curia) in Pfaffstetin[5].

Die Bestätigungsurkunde Rudolf
von Habsburg 1277 spricht zwar wieder nur von 8 Weingärten und keinem Hof, aber
diese Urkunde bezieht sich ausdrücklich auf die Stiftungen von Leopold und
Friedrich.[6]
Dass die Lilienfelder aber nun
massiv in Pfaffstätten "einkaufen", darüber besteht kein Zweifel:
1288: Otto de Rastenberch und Albero
de Hohenstain verkaufen ihren Wald genannt Hvenerperch bei Pfafsteten
um 20 lb[7] an
Abt Chunradus vom Kloster Lilienfeld.[8]
Weitere Weingärten und Äcker sind von den Heiligenkreuzern gepachtet,
wie aus dem Grundbuch 1293
hervorgeht[9],
aber auch vom Stift Klosterneuburg.
Trotzdem taucht in den Urkunden kein Verwalter Lilienfelds in
Pfaffstätten auf, um 1300 werden Lilienfelder Rechtsgeschäfte vom
Heiligenkreuzer Amtmann Gerhard in Pfaffstätten getätigt. [10],[11] Die Pacht der Pfaffstättener Weingärten an das Stift Klosterneuburg
wird vom Kämmerer in Lilienfeld gezahlt. [12] Allerdings könnte Leopold der Kämmerer mit Leupold von Lyrnueld,
Hofmeister zu Pfaffstätten, der um 1307
erstmals genannt wird, ident sein.
1307, Baden: Albrecht der Hveter
und Albrecht der Stayner von Paden urkunden als Schiedsleute
zwischen Bruder Leupold von Lyrnueld,
Hofmeister in Phaffstetn, und Hainrich dem Mvllner, des Mayrs
Sohn, der dem Lilienfelderhof in der Scheiben[13]
großen Schaden zugefügt hat.[14]
Die
Bestätigungsurkunde König Friedrichs von 1316 auf alle Besitzungen und Rechte gemäß der Urkunde Herzog Albrechts
gibt wieder nur die 8 Weingärten an, aber hier wird offensichtlich nur ein
altes Recht bestätigt[15].
1319 ist wiederum ein Hofmeister aktenkundlich: Alber Hofmeister in Phafsteten tritt als Zeuge auf:
Abt Otaker und der Konvent
von Lienveld beurkunden die Stiftung Vlreich des Hertzogs
von Phafsteten und seiner Frau Geisel; Stiftungsgut ist der
Weingarten Legsenprecht
am Padnerperge, der bis
zum Tode des Stifters in dessen Besitz bleibt; danach werden dafür am
Margareten- und Simonstag 2 Jahrtage abgehalten, wofür der Konvent je 12 ß[16]
bekommt: die Stifter erhalten das Begräbnisrecht in Lilienfeld zugesichert;
Geisel gibt noch für ihren verstorbenen 1. Mann Vlreich der Hertzog
einen neugesetzten Weingarten auf dem Stainfeld dem Konvent zur Pitanz[17]
und 1 lb für Mehl am Peterstach in dem lantzen (Februar 22).[18]
Und 1232 schließlich wird der
Lilienfelderhof offenbar umgebaut:
Der Wiener Bürger „Jacob der Meserl“
gestattet Abt Otaker und dem Konvent von Lilnueld, „zwei gipel zu
mauern auf meines hofes zu Phafsteten
maur“.[19]
Was hat es nun mit diesem Baujahr
1216 des Lilienfelderhofes in Pfaffstätten auf sich? Dazu müssen wir zurück ins Jahre 1747.
 In diesem Jahr veröffentlicht der
Lilienfelder Mönch Chrysostomus Hanthaler auf Veranlassung seines Abtes eine
Chronik seines Stiftes, die Fasti
Campilienses. Der bis dahin untadelige Numismatiker und Historiker hat aber
ein Problem: über die Gründungsjahre gibt es im Stift einfach zu wenig
Dokumente. Da gehen dem aus einfachen Verhältnissen in Bayern stammenden
Chrysostomus die literarischen Pferde durch: er erfindet den Chronisten Ortilo, einen angeblichen Zeitgenossen
der Klostergründung, der angeblich selbst Erlebtes niedergeschrieben haben soll[20].
In diesem Jahr veröffentlicht der
Lilienfelder Mönch Chrysostomus Hanthaler auf Veranlassung seines Abtes eine
Chronik seines Stiftes, die Fasti
Campilienses. Der bis dahin untadelige Numismatiker und Historiker hat aber
ein Problem: über die Gründungsjahre gibt es im Stift einfach zu wenig
Dokumente. Da gehen dem aus einfachen Verhältnissen in Bayern stammenden
Chrysostomus die literarischen Pferde durch: er erfindet den Chronisten Ortilo, einen angeblichen Zeitgenossen
der Klostergründung, der angeblich selbst Erlebtes niedergeschrieben haben soll[20].
Diese mit „G’schichterln“
durchsetzte Stiftschronik nimmt nun seinen Lauf durch die Dezenien:
1768 veröffentlicht Friedrich Wilhelm Weiskern eine
„Topologie von Niederösterreich“ und teilt uns zu Pfaffstätten mit:
„….Der Mayrhof dieses Stifts (Anm.: Lilienfeld)
allhier ward A(nno) 1216 erbauet, wozu Lupold von Sachsengang A(nno) 1261
Grundstücke schenkte. Eben dieses Kloster Lilienfeld kaufte A(nno) 1288 den
hiesigen Wald Hühnerberg von Otten von Rastenberg (Hanthaler(sic!))“[21]
Der nächste Chronist auf Hanthaler’s Spuren ist Ambros Beczicka, Capitular in Lilienfeld.
Im Vorwort zu seiner 1825 erschienenen Topologie des Stiftes Lilienfeld
schreibt er: „Das Materiale lieferten mir Hanthaler’s Fasti, sein schriftlicher
Nachlass, das Stiftsarchiv, der nächsten Zeit Mitgenossen, und der Mitzeit
Selbsterfahrung“[22].
Nachdem er eine päpstliche Bestätigungsurkunde mit 3 (statt 2) Weingärten in
Pfaffstätten anführt[23],
schreibt er[24],
dass unter Abt Gebhard Herzog Leopold[25]
vor einem Kreuzzug[26]
am Aschermittwoch 1217 auf dem Zug nach Gräz durch Marienthal (Lilienfeld) kam
und dort nicht nur den Fortschritt des Kirchenbaus, des Kreuzganges, des
Spitals und des Pforten-Wirtshauses in Augenschein nahm, sondern auch hörte,
dass in "Pfaffstätten an einem Hofe
gebaut werde"[27].
Zeitgleich gibt Pater Malchias Koll, Capitular zu Heiligenkreuz und Pfarrer in
Pfaffstätten, zum Besten: "Im Jahre 1216 wurde der hiesige
Lilienfelder-Stiftshof erbaut“[28]
[29]
Bei Freiherrn Friedrich von Sickingen wird 1832 aus der Geschichte Folgendes:
"Dieser Stiftshof wurde schon 1216 erbaut und 1288 vom Stifte von Otto von
Kastenberg erkauft."[30].
Das
Gründungsdatum 1216 für den Lilienfelderhof steht also auf ziemlich wackeligen
Füßen. Man fragt sich, ob für 2 oder 3 Weingärten ein eigener Wirtschaftshof
notwendig gewesen sein soll, noch dazu, wo die Heiligenkreuzer Mitbrüder seit
1141 in Thallern eine große Weinbau-Grangie besaßen. Eine
ganz andere Frage ist das Alter des Baues an sich, hier kann nur ein Baubefund
Aufschluss geben.
Der Bedeutung
dieses einmaligen Ensembles eines mittelalterlichen zisterziensischen Wirtschaftshofes
tut das aber keinen Abbruch.
